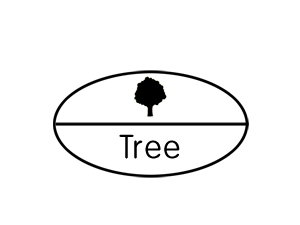trotzdem – trotzdem
Sonntag, 14. September 2008Wir saßen neulich bei einem Glas Rioja und Fischfilet am Mittagstisch, als mein Mann plötzlich verwundert bemerkte, dass man das Wörtchen „trotzdem“ einmal vorne und einmal hinten betonen kann. [Trotz-dem‘] es gestern regnete, ging ich spazieren. Es regnete, [trotz‘-dem] ging ich gestern spazieren. [Trotz‘-dem]? [Trotz-dem‘]? Seltsames Wort; ich grübelte. Müßte es nicht eigentlich trotz-des heißen? Trotz des gestrigen Regens ging ich spazieren! Obwohl es gestern regnete, ging ich spazieren. Es regnete, obwohl ich spazieren ging… Nein! das ist nicht sinnig.
Ich hatte mich im Zuge meiner Metrikbemühungen mit den Regeln der deutschen Wortbetonung befaßt und konnte mir demnach sehr gut erklären, warum es einmal [um‘-schrei-ben] und ein anderes mal [um-schrei‘-ben] heißt. Das sind nämlich verschiedene grammatische Phänomene und die Bedeutung ist auch jeweils eine andere. Denn das eine mal schreibt man etwas Existierendes neu und das andere mal sagt man etwas mit anderen Worten. Beim einen mal handelt es sich um ein Derivat des Verbes „schreiben“ mit dem betonten Präfix „um“, das sowohl synthetisch als auch analytisch auftreten kann: Ich schreibe den Roman um. Beim anderen mal handelt es sich um ein Adverb-Verb-Kompositum, das man nicht analytisch verwenden kann: Ich umschreibe es dir mit anderen Worten. (Ich schreibe es dir mit anderen Worten um, geht nicht.) Ähnlich ist es übrigens bei [ü‘-ber-set-zen] und [ü-ber-set‘-zen]. Man kann nämlich ans andere Ufer übersetzen oder einen englischen Roman ins Deutsche übersetzen.
Ich habe auch andere interessante Worte gefunden, bei denen der eigentlich feste Wortakzent von Derivat zu Derivat hüpft, obwohl es sich nicht um ein Fremdwort handelt: [miss-gön‘-nen], aber [Miss‘-gunst] und [wi-der-ru‘-fen], aber [Wi‘-der-ruf]. Auch hier ist klar, das eine ist ein Verb, das andere ein Substantiv. Aber trotzdem?
1. Trotzdem‘ es gestern regnete, ging ich spazieren.
2. Es regnete, trotz’dem ging ich gestern spazieren.
3. Es regnet, aber ich spaziere trotz’dem.
4. Trotz des Regens, ging ich gestern spazieren.
Es macht semantisch keinen großen Unterschied, ob ich [trotz-dem‘] oder [trotz‘-dem] sage. In den ersten beiden Beispielsätzen leiten beide trotzdems einen Nebensatz ein, an dessen Anfang sie stehen. Dennoch kann man im ersten Beispiel ein „obwohl“ einsetzen und im zweiten nicht, es sei denn man ändert die Satzordnung: Es regnete, obwohl ich gestern spazieren ging. Der Sinn ist nicht derselbe und besonders sinnvoll wird dieser Satz auch nicht, aber grammatikalisch ist er einwandfrei. „Obwohl“ ist, ähnlich wie „weil“ oder „dass“ eine Konjunktion, also könnte [trotz-dem‘] im ersten Beispiel auch eine sein.
Um was für eine Wortart handelt es sich aber beim zweiten Beispiel, um ein Adverb, eine Konjunktion? Vielleicht ist es ein Partikel, eine Präpositionen wie im vierten Beispiel wird es nicht sein. Wir kommen hier an die Grenzen der traditionellen Wortartenlehre. Der Umstand, dass die zweite Variante anders betont wird, läßt mich daran zweifeln, dass es sich um dieselbe Wortart handelt, auch wenn die Satzpositionen und Funktionen (am Anfang des Nebensatzes, den sie einleiten) dieselben zu sein scheinen.
Das [trotz‘-dem] im dritten Beispiel würde ich persönlich für ein Adverb halten. Als Adverb betrachtet der Duden Wörter wie „abends“ und „bald“, während er Wörter wie „sehr“ und „ziemlich“ für Partikel hält. Ich hätte auch letztere für Adverbien gehalten.
5. Ich komme bald. (Adverb)
6. Ich komme trotz’dem. (Adverb?)
7. Ich liebe ihn ziemlich. (Partikel?)
8. Ich liebe ihn trotz’dem. (Partikel?)
Ich würde das vorne betonte „trotzdem“ für ein Adverb halten, sowohl in Beispiel 2 als auch 3, denn man kann beide Varianten auch mit dem Wörtchen „bald“ um‘-schrei-ben, was ja ein duden-zertifiziertes Adverb ist.
9. Es wurde dunkel, bald ging ich heim.
10. Es wurde dunkel und ich ging bald heim.
Dass [trotz‘-dem] und [trotz-dem‘] unterschiedlich betont werden, könnte also daran liegen, dass es sich bei dem einen um ein Adverb, bei dem anderen um eine Konjunktion handelt und nur zufällig beide unflektierten Formen gleich aussehen. Wenn mir jetzt noch jemand den Unterschied zwischen Adverbien und Partikeln begreiflich machen könnte, würde der Knoten in meinem Kopf vielleicht platzen. Trotzdem‘ ich keine Ahnung habe, hilft mir das Nachdenken über solche Probleme trotz’dem. So ist das mit den linguistischen Sinnkrisen am Mittagstisch.