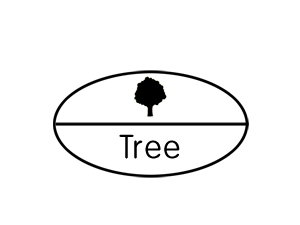Donnerstag, 27. März 2008 17:15
Die rhetorische Periode ist ein Ordnungsprinzip formaler Sprache, das meine Sicht auf den freien Vers verändert und geschärft hat. Die Ästhetik der Ausgewogenheit von Wiederholung und Variation, aber auch die Freiheit und Flexibilität individueller Musterbildung erzielen eine spezifische Wirkung und üben einen besonderen poetischen Reiz aus.
Die rhetorische Periode
Ich habe früher oft Texte kritisiert, die sich nur durch optische Zeilenumbrüche als Gedichte zu erkennen gaben, sonst aber formal der Prosa entsprachen. Die Kritisierten wandten ein, dass es sich doch um freie Verse handle, aber ich hatte daran stets meine Zweifel. Mit dem Begriff „Vers“ verband ich einen Grad an Formalisierung, der über Prosa hinausgeht; „frei“ bedeutete für mich nur, dass die sprachliche Formalisierung nicht nach dem einheitsstiftenden metrischen Prinzip funktioniert, sondern nach einem fein ausgewogenen Spiel von Wiederholung und Variation, von Dynamik und Pause, Spannung und Entspannung, Regelaufbau und Regelbruch, etc. pp.
In Manfred Fuhrmanns „Antiker Rhetorik“ (im übrigen eine insgesamt sehr empfehlenswerte Lektüre) stieß ich schon vor einigen Jahren auf das formale Prinzip der rhetorischen Periode, das ich für einen wichtigen Aspekt zum Verständnis des freien Verses halte. Das trifft natürlich auch auf den metrischen Vers zu, denn kein zeitliches Ereignis in ihm ist einheitlicher, als die wiederholte Abfolge von Hebung und Senkung. In der rhetorischen Periode haben wir es aber mit syntaktischen Einheiten zu tun, die sich als Kola oder Kommata in einer sehr sorgsam gegliederten Binnenstruktur präsentieren. Zu solchen Kola oder Kommata finden sich Worte, Phrasen und Sätze. Jeder Linguistikstudent wird die hierarchischen Stemma kennen, die sich aus einer Satzanalyse ergeben. Bei einer rhetorischen Periode liegt eine wie auch immer geartete Form von Symmetrie innerhalb dieses Stemmas vor.
Ein Beispiel des Fachbereichs Linguistik der Uni Potsdam:
- Wie lange noch, Catilina, willst du unsere Geduld missbrauchen? Willst du uns mit deiner Tollheit noch lange verhöhnen? Merkst du nicht, dass deine Dreistigkeit vermessen ist?
- Wie lange noch, Catilina, willst du unsere Geduld missbrauchen? Bis wann soll deine Tollheit uns noch verhöhnen? Wie weit wird zügellose Dreistigkeit sich noch vermessen?
Inhaltlich haben beide Texte gleichen Gehalt. Formal unterscheiden sie sich aber erheblich voneinander, wodurch sie eine völlig andere Wirkung entfalten. Sehr deutlich zeigt der zweite Text ein Ordnungsprinzip, das auf der Parallelisierung der syntaktischen Einheiten beruht, ergo der rhetorischen Periode entspricht. Jeder der drei Sätze im zweiten Text ist grammatisch gleich oder sehr ähnlich gebaut. Es handelt sich um drei Fragesätze, die zuerst eine adverbiale Angabe, dann das finite Verb, dann das Subjekt, dann das Akkusativobjekt und zu letzt ein infinites Verb anführen.
| adverbiale Angabe |
finites Verb |
Subjekt |
Akkusativobjekt |
infinites Verb |
| Wie lange noch |
willst |
du |
unsere Geduld |
mißbrauchen? |
| Bis wann |
soll |
deine Tollheit |
uns |
verhöhnen? |
| Wie weit |
wird |
zügellose Dreistigkeit |
sich |
vermessen? |
Das Prinzip der Wiederholung ist hier also die Parallelisierung der Phrasen. Variation findet sich im ersten Satz durch die eingeschobene Anrede „Catilina“, in nachfolgenden durch das eingeschobene Partikel „noch“, im letzten durch die Rückbezüglichkeit des Objektes „sich“ und in vielen weiteren, kleinen Details. Doch die Parallelisierung ist nur eine Möglichkeit der syntaktischen Ordnung, weitere könnten die Reihung (a1, a2, a3), der Chiasmus (a1 b1 a2 b2), der Krebs und Spiegelung (a1 b1 b2 a2), die Mehrung (a ab abc), die Identität (a, a, a) und dergleichen mehr sein. Die Einheiten können Phrasen, wie Wortgruppen sein, können einzelnde Wörter betreffen (z.B. in der Aufzählung), können Wortarten betreffen oder ganze Sätze.
Die rhetorische Periode präsentiert sich also formal geschlossen, in ihrer Ordnung aber in sich sehr variabel und flexibel. Pausen entstehen an Nahtstellen, aber die Länge der Pausen ist unterschiedlich, ebenso schwankt die Betonungsstärke der betonungstragenden Elemente. Sie ist reizvoll locker gebunden, wirkt aber weder willkürlich, noch wie ein stechschrittiger Marsch. Die Schwierigkeit besteht nicht so sehr in der grammatischen Sachkenntnis (die kann man sich zur Not anlesen, wenn man sie nicht intuitiv mitbringt), sondern in der Sensibilität für Maß und Gewichtung von Einheiten und daraus resultierenden Klangphänomenen, wie Pausen und Betonungen. Die Ästhetik zerbricht hier, wie überall, an einem zu hohen Maß an Wiederholung (daraus folgt Langeweile), ebenso wie an einem zu hohen Maß an Variation (daraus folgt Unordnung).
Von der rhetorischen Periode zum freien Vers
Man kann dieses freie Ordnungsprinzip der rhetorischen Periode über syntaktische Aspekte hinaus weiterspinnen und z.B. auch den Bereich der Phonetik, Semantik und Morphologie mit einbeziehen. Sogar Annäherungen an metrische Prinzipien durch Musterbildung in Silbenzahlen und -längen/Betonungen ist denkbar. Als Beispiel dient der erste Absatz von Friederike Mayröckers „Ode an einen Ort“:
Heimstätte meiner Träume: Hütte Thron Türme Gebälk
Glocken Taubenschwarm vielflügelig verbrieft
geschnäbelt ins graue Licht
ätzend den Trauerhimmel
mit Botschaft von Dir zu mir:
Obwohl dieses Gedicht nicht metrisch ist, zeigt schon die erste Zeile ein deutlich höheres Maß an formaler Gebundenheit als jede Prosa. „Heimstätte meiner Träume: Hütte Thron Türme Gebälk“ – Hier wird vorallem viel mit dem Reim gearbeitet, die syntaktische Figur schließt sich im Zweiten Teil der Zeile dieser Reimschematik an. Man beachte Zunächst die Häufung an /t/ /ä/ /äu/ und /ü/. Dann folgt die Sequenz „Träume – Hütte – Thron – Türme – Gebälk. Dies ist syntaktisch gesehen eine Reihung, Aufzählung, lautlich ist sie am /o/ von Thron gespiegelt: ä-ü-o-ü-ä. Semantisch wird der Traum zur Spiegelachse, denn die vier folgenden Begriffe sind Lokalitäten (Orte), ebenso wie die „Heimstätte“ am Anfang der Zeile. Es finden sich weitere Klangparallelen zwischen /ei/ und /äu/ und zwischen /äu/ und /ü/. Auch das /h/ wird exponiert. Das harte Gebälk am Schluß sprengt diese Klangkaskade schroff auf, nicht nur durch seinen stimmhaften, gutturalen Anfang /g/, sondern auch und vorallem sein gutturales und stimmloses Ende /k/ (harte Kadenz). Wir haben es hier mit einem Paradebeispiel dür den freien Vers zu tun, nicht metrisch, nicht prosaisch, sondern ein Ding in der Mitte.
Eine solche formale Strukturierung von Sprache macht den grafischen Zeilenumbruch als Kennzeichnung poetischer Sprache meines Erachtens überflüssig, da die Sprache selbst schon ausreichend poetisch ist, um nicht als Prosa verkannt zu werden (was nicht heißt, dass der Zeilenumbruch keine berechtigte Funktion hätte). Aber hier zeigt sich, warum auch die im Fließtext gedruckten „Petites poèmes en prose“ von Baudelaire auch ohne optische Gliederung durch Zeilenumbrüche immer noch als verses libres zu erkennen sind.
Ich habe mich selbst nie an den vers libre gewagt, weil ich ihn in der Tat für ein Wagnis, ein höchst anspruchsvolles Unterfangen halte. Aber ich habe sehr schöne freie Verse gelesen und mich in Prosatexten schrittweise in der freien formalen Musterbildung probiert. Der freie Vers ist und bleibt ein äußerst interessantes sprachliches Phänomen; die rhetorische Periode hat mir geholfen, mich dafür zu sensibilisieren.
________
Quellen:
- Manfred Fuhrmann, „Die antike Rhetorik“, Artemis & Winkler, 19954, S. 139f
- Mayröcker zitiert aus: Karl Otto Conrady, „Das grosse deutsche Gedichtbuch“, Athenäum Verlag, 1977