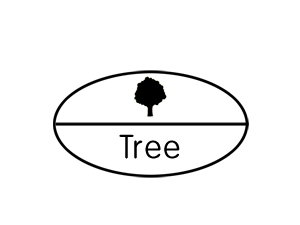Eigentlich wollte ich ja heute einen längst fälligen Post über deutsche Metrik veröffentlichen, aber da ist mir ein Text vor die Augen gefallen, der eine sinnvolle Low-Tech-Lösung für unser Energieproblem vorstellt und das zu lösen, ist noch viel dringender als Poetik. Also schreibe ich nun darüber, dass Peak Oil erreicht ist und Kernspaltung und Fusion uns nicht retten werden, stelle aber ein Konzept vor, das die weltweite Komplettversorgnung mit Solarenergie nicht mehr illusorisch erscheinen läßt.
Alternative Energiequellen
Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine zum andern: „Oh, du siehst aber mies aus. Was hast du dir denn eingefangen?“ Darauf der andere: „Mensch.“ „Ach, keine Sorge“, verkündet der erste, „das geht vorbei.“
Derzeit lebt der Mensch auf der Erde wie ein Parasit. Er verbraucht mehr Ressourcen als nachwachsen, er rodet Wälder, überfischt die Meere, und verschmutzt Land, Luft und Wasser mit seinem Dreck und Müll. Und er benötigt dabei so ungeheuer viel Energie, dass inzwischen der Punkt erreicht ist, an dem die Fördermenge des Erdöls nur noch abnimmt. In einem wissenschaftlichen Bericht der Energywatchgroup vom Oktober 2007 [PDF] heißt es, dass „Peak Oil“ bereits im Jahr 2006 erreicht wurde. Das Jammern, das Ermahnen der Umweltforscher und -aktivisten, die sinnlosen Kriege gegen die OPEC-Staaten, all das hilft nichts. Wenn das Öl alle ist, wird es kalt in Europa und so langsam aber sicher müssen wir uns darauf einstellen, dass das nicht unsere Kinder oder die Kinder unserer Kinder betrifft, sondern uns. Den Tag, an dem uns das Öl ausgeht, werden wir in näherer Zukunft erleben. Denn dass der Mensch seine Verantwortung erkennt und seinen Energieverbrauch reduziert, bevor die Energiequellen erschöpft sind, erscheint illusorisch.
Alternativen müssen her, doch welche? Verlängerte Laufzeiten von Atomkraftwerken, wie sie die CDU derzeit vorschlägt, werden uns nicht retten, da auch die Uranquellen langsam versiegen. Neuer Atommüll würde anfallen, der wiederum irgendwo verklappt werden müßte.
Eine stille Hoffnung von mir, war ja lange Zeit die kalte Fusion. Warum diese aber, selbst wenn sie in den nächsten Jahren gelingen sollte, keine Alternative ist, verraten diese Slides von der ASPO6 Conference im September 2007. Der derzeit verfolgte Ansatz für die Energiegewinnung aus der exothermen Kernfusion besteht darin, einen Deuterium- (2H) mit einem Tritium-Kern (3H) unter Abspaltung eines Neutrons zu einem Heliumkern (H2) zu verschmelzen. So funktionieren Wasserstoffbomben, doch natürlich wollen wir nicht, dass uns der Reaktor um die Ohren fliegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch beherrschbare Technologie ist. Das Problem: Woher bekommen wir Tritium?
Tritium hat eine Halbwertzeit von ca. 12 Jahren, dann zerfällt es. Es ist radioaktiv und entsteht auf natürlich Weise in den oberen Schichten der Erdatmosphäre durch den Beschuß von Stickstoff mit kosmischer Strahlung. Es fällt auch als Nebenprodukt bei der Kernspaltung an. Allerdings bräuchte ein Fusionsreaktor ca. 56 kg Tritium pro Jahr. Atomkraftwerke liefern derzeit nur wenige Kilos und künstlich mehr Tritium herzustellen, ist bisher aussichtslos. Das Uran für die Kernspaltung ist laut Dr. Michael Dittmar um 2009/2010 alle und Tritium für die Kernfusion kann nicht in ausreichendem Maß produziert werden. Abgesehen davon erzählen Experten seit 20 Jahen, dass die Fusion frühenstens in 30 Jahren funktioniert. Unsere Hoffnungen auf Kernenergie zu lenken, ist scheinbar vergebe Mühe.
Anders sieht das mit erneuerbaren Energiequellen aus. Wasser-, Wind-, Solar-, Geothermie-, Erdrotation-, Biomasse- und Gezeitenkraftwerke sind vorstellbar. Derzeit tragen erneuerbare Ressourcen ca. 6-7 PJ Anteil am Primärverbrauch, Tendenz steigend. Das Problem war bisher, diese Energien zu speichern, bzw. eine konstante Versorgung sicher zu stellen. Denn bei Flaute gibt es bisher keine Windenergie und bei Nacht keine Sonnenenergie. Das könnte sich aber zukünftig ändern, da es inzwischen sinnvolle Ansätze gibt, dieses Problem zu lösen.
Schon im September 2007 schrieb der Spiegel von der Idee zweier us-amerikanischer Brüder, die Windenergie in Druckluft speichern wollen, und zwar nahezu verlustfrei. Gewöhnliche Windräder fangen dazu den Wind auf. Anstelle eines Generators, der die Rotation in Energie umwandelt, befindet sich aber ein Druckluftkompressor in den Rädern. Die komprimierte Druckluft kann dann in alten Erdgasblasen, Salzstollen oder sonstigen Kavernen gespeichert werden. Das Manko ist nur, dass beim Komprimieren Wärme entsteht und beim Dekomprimieren Wärme benötigt wird. Um also den Energieverlust bei dem Verfahren geringt zu halten, müßte ein solcher Windbark mit einem gewöhnlichen Wärmekraftwerk kombiniert und die gespeicherte Druckluft in die schon angewärmte Turbine eingespeist werden.
Sinnvoller erscheint mir ein Ansatz zur Speicherung von Sonnenenergie. Desertec ist eine Vision, die riesige Parabolspiegelfelder an unbewohnten, endlos sonnenbescheinten Orten vorsieht – Wüsten. Ein Feld von der Größe Österreichs mitten in der Sahara könnte den derzeitigen Weltbedarf an Energie decken. Zugleich könnte es die nötige Energie für die in Wüstenregionen dringend nötigen Wasserentsalzungsanlagen liefern und so die Versorgung mit Trinkwasser sicherstellen. Die Parabolspiegel wären an langen Rinnen in Nord-Süd-Ausrichtung angebracht und könnten so dem Lauf der Sonne folgen, um deren Wärmestrahlung zu sammeln. Um auch in der Nacht die Energieversorgung sicher zu stellen, könnte die Sonnenwärme dazu genutzt werden, Salzkristalle zu schmelzen. Kristalisieren diese geschmolzenen Salze wieder aus, geben sie Wärme ab.
Unsere Rettung könnte also tatsächlich so funktionieren, wie diese kleinen Beutelchen, die man im Winter in der Apotheke kaufen kann, die ein kleines Metallplättchen und geschmolzenes Salz enthalten, das auskristalisiert, sobald man das Plättchen knickt. Wenn wir jetzt alle in Null-Energie-Häuser ziehen, vielleicht schaffen wir es ja dann, endlich über unser Parasitendasein hinauszukommen. Müßten wird nur noch unser Müll- und Lebensmittelproblem lösen.
Ich freue mich über informative Links und konstruktive Ideen zu diesem Thema.