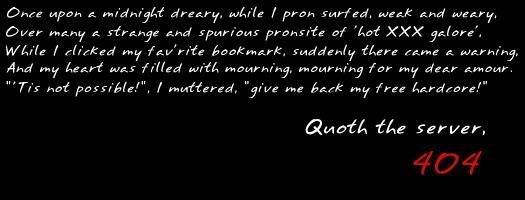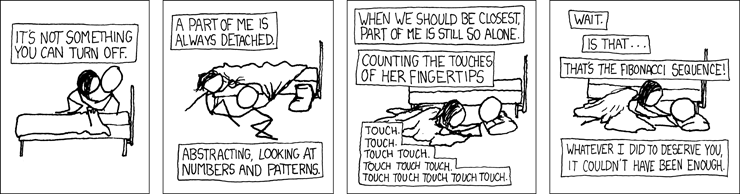Lai, Leich [poet. Formprinzip]
Sonntag, 27. Januar 2008Gerade bereite ich mich auf eine Arbeit zu altfranzösischen Lais und eine mündliche Prüfung zu mittelhochdeutschen Leichen vor und habe deshalb den Kopf voller Ideen zu dieser unstrophischen, lyrischen Gattung. Aber jeder, dem ich davon erzähle, fragt erst einmal: „Leich, hä, was’n das?“ Dieser allgemeinen Unwissenheit soll hiermit Abhilfe herbeieilen.
1. allgemeine Einführung
1.1 Definition
„Die Bezeichnung lai/leich ist im Mittelalter ein Sammelbecken für monodische Werke in den Volkssprachen, die sich der Gleichstrophigkeit entziehen; Kontrapart bildet das Liedprinzip“, heißt es im MGG2 Artikel von Christoph März. Diese kurze Definition faßt die grundlegenden Prinzipien des poetischen Phänomens, das hier zur Disposition steht, ganz treffend zusammen, wie ich finde. Es gibt aber noch weitere Phänomene, die mit dem Begriff in Verbindung gebracht werden.
1.2 Lai-Arten
Dazu gehören zunächst die um 1160 von Marie de France verfaßten, märchenhaften Erzählungen in achsilbigen Reimpaarversen. Zu diesen ist keine Musik überliefert, Hinweise im Text und ein leeres Notensystem in einer der Quellen verweisen aber auf die Existenz von dazugehöriger Musik. Da Marie selbst sagt, sie hätte bretonische Vorlagen niedergeschrieben, wird diese Art des Lais auch lai breton genannt. Eine andere Bezeichnung ist lai narrativ. Ebenfalls in Richtung Bretagne und König Arthus weisen die strophischen Lais, die in diversen Romanen, allen voran dem Tristan en prose, als kurze Liedeinschübe den Helden der Geschichte in den Mund gelegt werden. Diese Lais sind metrisch und melodisch sehr einfach gebaut und man nennt sie lai arthurien. Die aufgrund ihrer Überlieferungslage für die Wissenschaft interessantesten Lais sind aber die lais lyriques, die im deutschsprachigen Raum auch leiche genannt werden. Sie nehmen als verhältnismäßig lange und komplexe lyrische Gattung schon im Repertoire der Troubadours, Trouvères und Minnesännger eine Sonderstellung ein und gelten wohl besonders im 13. Jahrhundert als Königsdisziplin der Lieddichtung.
Es gibt weitere Phänomene, die in dieser oder jener Quelle mit dem Begriff bedacht werden, die wichtigstens und häufigsten sind jedoch die drei oben genannten, allen voran das lyrische Lai.
1.3 Etymologie und Terminologie
Es gibt diverse Thesen zur Etymologie des Begriffs lai/leich, zum Beispiel von Ferdinand Wolf, Richard Baum oder Hermann Apfelböck, die den Begriff aus dem keltischen, germanischen, bretonischen oder lateinischen herleiten. Angeführt werden dabei das altirische loîd/laîd (Lied, 9.Jh.), das gotische laikan (springen, tanzen, bewegen), das althochdeutsche leih (Gesang, Melodie), das angelsächsische laic, lac (Gabe) und das mittellateinische laicus/laice. Obwohl beides nicht denselben Weg gegangen sein muß, vermischen einige dieser Thesen die Wort- und die Sachgeschichte miteinander. Weder über das eine, noch über das andere gibt es aber bisher einen wissenschaftlichen Konsens.
Denn als Gattungsbegriff taucht lai zuerst um 1140 in den Chansonniers der provenzalischen Troubadours auf. Darin tragen einige Stücke Titel wie „Lai Markiol“, „Lai non par“, etc. Im Norden Frankreichs findet sich der Begriff zuerst 1155 in Waces „Roman de Brut“. Marie de France rückt mit ihren 12 narrativen Lais den Begriff erstmals in bretonischen Kontext, in dem er in weiteren epischen Werken ab 1200 und 1210 auch in provenzalischen und mittelhochdeutschen Quellen zu finden ist. In diversen althochdeutschen Glossen findet sich der Begriff bereits ab dem 10. Jahrhundert im musikalischen Kontext, z.B. bei Notker („lied unde leicha“). Im deutschen Sprachraum lassen sich die frühesten Leiche um 1175 datieren.
1.4 Probleme bei der Definition
Die Definition des Begriffs ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Im Mittelalter werden unterschiedliche Phänomene lai genannt, die wiederum aber auch diverse andere Namen tragen können. Die Thesen zur Etymologie bringen nicht wirklich weiter und liefern allenfalls Spekulationen über das Ding an sich, das nicht zuletzt auch deshalb schwer zu fassen ist, weil es das Prinzip einer individuellen Formenphysiognomie verfolgt und darob ganz unterschiedliche Erscheinungen ausgebildet hat. Auch die Annäherung über ähnliche Formen, wie Sequenz, Planctus, Conductus, Descort, u.a. ist schwierig, weil diese ebenfalls nicht klar umrissen sind.
2. zeitlich-regionale Entwicklung
2.1 Lais als Volkspoesie
Bereits 1841 entwickelt Ferdinand Wolf die These, das Lai sei seinem Wesen nach eine Gattung der Volkspoesie und entwickle sich erst später zu einer höfischen Kunstform. Obwohl diese Behauptung aufgrund fraglicher Prämissen relativiert werden muß, stützt sie sich doch auf einige interessante Beobachtungen. Die (provenzalischen) Lais, welche heute als zur ältesten Schicht gehörig ausgemacht werden können, sind allesamt anonym überliefert. Sie weisen größtmögliche Formenvielfalt auf, sind weniger lang, dafür repetitiver und metrisch, wie melodisch einfacher gebaut als ihre mit Namen überlieferten provenzalischen und altfranzösischen Nachfolger. Erst im Verlaufe der Zeit entwickelt sich eine Tendenz zur Musterbildung heraus, bis das Lais im 14. Jahrhundert bei Guillaume de Machaut seine endgültige, normative Form erhält.
In eine ähnliche Richtung weist Bruno Stäblein mit seiner These zum descort. Der Begriff taucht im Provenzalischen irgendwann als Selbstbezeichnung in Stücken auf, die nach formalen und inhaltlichen Kriterien durchaus Lais sind und auch im selben Kontext überliefert werden. Stäblein behauptet, dies geschähe zur Abgrenzung der Troubadours-Kunst vom volkspoetischen Lais. Im altfranzösischen Sprachraum werden beide Begriffe aber synonym verwandt. Einziges distinktes Merkmal ist, dass Descorts inhaltlich ausschließlich um die „amour courtois“ kreisen (während Lais auch religiöse Topoi verfolgen) und in keinem Fall anonym überliefert sind.
2.2 Lais/Leiche vor 1300
Einen Konsens über die Entstehungsdaten einzelner Lais vor 1300 gibt es nicht, da diese größtenteils alle in denselben Quellen überliefert sind und man allein aufgrund kompositorischer Unterschiede keine handfesten Aussagen machen kann. Den Versuch einer Chronologie unternimmt David Fallows in seinem New Grove Artikel zum Lai, wobei er verschiedene Thesen der Lai-Forschung zusammenträgt. Es sind mehr altfranzösische Lais vor 1300 überliefert als provenzalische, was aufgrund der Quellenlage nicht verwundert. Es läßt sich feststellen, dass weniger Lais vor 1200 überliefert sind, die meisten aus der Zeit vor 1300 stammen und nach 1300 nur noch wenige komponiert werden.
2.3 Lais im Fauvel und bei Machaut
Zu diesen späten Beispielen gehören die vier französischen Lais im Roman de Fauvel, sowie die 19 Lais von Guillaume de Machaut. Im Register des Roman sind unter der Kategorie „proses et lays“ 27 Titel aufgeführt, davon drei französische und 24 lateinische Stücke. Aber das Register ist nicht nur an dieser Stellle fehlerhaft und so finden sich insgesamt 31 Stücke, die in diese Kategorie passen, von denen vier französische Lais sind; eines davon bezeichnet sich selbst als descort. Die restlichen Stücke sind lateinische Conductus oder Sequenzen („proses“), die dem Lai-Prinzip folgen, eines davon ist ein Kontrafakt des provenzalischen Lai Markiol. Die vier Lais gehören zum Modernsten, was der Roman musikalisch zu bieten hat und verweisen musikalisch bereits auf den Stil der Ars Nova, weshalb Leo Schrade Philippe de Vitry als Verfasser annimmt. Er glaubt, dass mindestens 3 der Stücke auch Guillaume de Machaut bekannt gewesen sein müssten, da sich direkte Einflüsse auf seine Lais nachweisen lassen. Während die Fauvel-Lais formal relativ flexibel bleiben, erhält die Gattung bei Machaut normativen Charakter und es kommt zur Ausbildung einer form fixe.
2.4 Kontinuität
Obwohl der Machaut-Schüler Eustache Deschamps in seiner Art de dictier (1392) beahuptet, Lais seien durchaus üblich, erscheint die Gattung im Roman de Fauvel und bei Machaut seltsam isoliert. Es ist fraglich, ob dies aufgrund einer schlechten Überlieferungslage zustande kommt oder weil das Lais einfach nicht zum üblichen Liedrepertoire der Zeit gehörte. Von keinem Zeitgenossen Machauts sind monodische Werke überliefert, allerdings ist auch kein Zeitgenosse so umfangreich überliefert wie Machaut. Die Melodien aus dem französischen Chansonrepertoire datieren nicht nach 1250 und so kommt es bis 1317, dem vermuteten Entstehungsjahr des musikalisch interpolierten Roman de Fauvel, zu einer Überlieferungslücke. Diese kann aber geschlossen werden, wenn man auf den deutschen Sprachraum ausweicht. Hier stammen zeitlich und stilistisch zwischenzuordnende Leiche von Hermann Damen und Heinrich von Meißen (Frauenlob). Aus der Zeit nach Machaut sind Lais nur noch aus dem Dichterzirkel um Eustache Deschamps, Christine de Pizan und Froissart überliefert. Diese sind allerdings nicht mehr musikalisch konzipiert, sondern rein literarisch. Somit steht Machaut mit seinen Lais in gewisser Hinsicht am Ende der Gattungsgeschichte.
3. poetische Form
3.1 allgemeine Prinzipien
Es gibt fast kein Lai, das dem anderen gleicht, jedes besticht durch individuelle Gestaltung und erschafft seine Regeln quasi aus sich selbst heraus. Das Gattungsprinzip, das sie alle miteinander verbindet ist die individuelle Formenphysiognomie, die in einem Verzicht auf Strophigkeit und sonstig regelhaft gesetzte Wiederkehr ihren Ausdruck findet. Jeder Vers ist unterschiedlich lang und verwendet andere Reimworte, kleinere Motive und Phrasen werden aber stetig wiederholt und variiert, bevor neues Material eingebunden wird, was zu einer oft komplexen, metrischen Binnenstruktur führt. Dies ist das zweite grundlegende Prinzip, welches in der Forschung mit „fortschreitende Repetition“ beschrieben wird. (Auch wenn es keine Strophen in dem Sinne gibt, handelt es sich formal um alles andere als „Prosa“. Größere Formabschnitte werden Versikel genannt.) Außerdem kommt es oft zur Verschleierung von Zäsuren und Kadenzen und zu Enjambements über die Versikelgrenzen hinaus. Die Enddifferenzierung in ouvert- und clos-Kadenzen, die Ausbildung paariger Komplexe (Doppelversikel), die Wiederaufnahme des Anfangs am Ende und die 12-„Strophigkeit“ werden im Verlaufe der Zeit formbestimmend. In den Melodien der Lais dominiert der G-Modus, während in den mhd. Leichen oft ein Terzengebäude über D oder F anzutreffen ist.
3.2 Verwandte Formen
Wegen dem doch etwas befremdlichen Prinzip der Unstrophigkeit ist das Lai immer wieder mit anderen Formen Verglichen und in generische Verbindung gebracht worden. Das ist zunächst der schon descort, von dem eigentlich ausgegangen wird, dass er unter das Lai zu subsummieren ist. Eine Identität wird auch zwischen dem frz. Lai und dem dt. Leich angenommen, obwohl der Begriff im dt. (vor 1210 bei Gottfried v. Straßbourg, der es aus dem frz. entnimmt) nie in Verbindung mit epischen und nur selten mit strophischen Werken steht.
Auch wurde immer wieder die Nähe zu lateinischen, unstrophischen Gattungen wie der Sequenz, dem Plactus und dem Condutus hingewiesen und in der Tat gibt es unter den frühen Lais einige Kontrafakturen, bzw. melodische Abhängigkeiten zu lateinischen Sequenzen und Plactus. Wobei hier nicht eindeutig ausgemacht werden kann, ob die volkssprachigen oder die lateinischen Stücke Vorlage waren. Bei Fauvel sind die lateinischen Strücke der Kategorie „proses et lays“ größtenteils Condutus. Allen gemeinsam ist der Verzicht auf regelhafte Wiederkehr metrisch-musikalischer Strukturen.
3.3 Beispiele
Ein durchaus kunstvolles Beispiel sind das erste und zweite Versikel des Lai des Hellequins „En ce douce temps d’esté“ aus dem Roman de Fauvel:
En ce douce temps d’esté, tout droit ou mois de may,
qu’amours met par pensé maint cuer en grant esmay,
firent les herlequines ce descort dous et gay.
Je, la Blanche Princesse, de cuer les em priai
et vous qu’em le faisant deîssent leur penser,
se c’est sens ou folie de faire tel essay
com de mettre son cuer en par amours amer.
Je, qui suis leur mestresse, avant le commencai
et en le faisant non de descort li donnay,
Quar selon la matere ce non si li est vrai.
Puis leur dis: „Mes pucelles, moult tres grant desir ai
qu’en fesant ce descort puissons tant bien parler
qu’on n’i truist que reprendre, que pour verité sai
que pluseurs le voudront et oir et chanter.“
I.) (Longa- Brevis und Semibrevis stehen im Verhältnis 1:3:9)
A 6 | 6a
B 6 | 6a
A 7_ | 6a
B 7_ | 6a
C 6 | 6b
B‘ 7_ | 6a (Kadenz variiert)
C‘ 6 | 6b (gesamter clos variiert)
(das ganze wird 1x wiederholt)
II.) (Loga-Brevis und Semibrevis stehen im Verhältnis 1:2:6)
A 6 | 6c
B 6 | 6c
C 7_ | 6d
C‘ 6 | 6d
A 6 | 6e
B 6 | 6e
Interessant ist an diesem Stück, dass die musikalische (Großbuchstaben) und die metrische Disposition nicht unmittelbar kongruent sind, was ungewöhnlich für die mittelalterliche Lieddichtung, nicht aber für das Lais selbst ist. Außerdem interessant ist der Umstand, dass hier mittels wörtlicher Rede eine Geschichte erzählt wird. Dies und auch die melodische Prosaik, sowie Länge des Lais lassen Zweifel an der reinen Lyrizität der Gattung aufkommen, die zwar von verschiedener Seite geäußert, aber nie eingehender untersucht wurden.
3.4 Das Lai als form fixe
Geschichtlich betrachtet ist das Lais alles andere als eine form fixe, es ist heterogen und sehr veränderlich. Allerdings strebt es mit zunehmender Entwicklung hin zu einer formalen Stabilisierung, die bei Guillaume de Machaut ihren Höhepunkt erreicht. Nur zwei seiner 19 Lais weisen eine andere Struktur, als die 1392 von seinem Guillaumes Schüler Eustache Deschamps beschriebene, auf. Die Norm lautet: 12 Teile von denen der erste und letzte in Form und Reim identisch sind, ohne dass sich Reimworte wiederholen, während die anderen 10 dahingehend individuell sind, doch jeder Teil muß vier Viertel haben. Bei Machaut wird mit dem letzten Versikel nicht nur die Form und der Reim, sondern auch die Musik des ersten Versikels wiederholt, diese erklingt jedoch für gewöhnlich eine Quarte oder Quinte höher oder tiefer.
Quellen
- Christoph März: „Lai, Leich“, in: MGG2
- David Fallows: „Lai“, in: New Grove2
- Hans Tischler: „Die Lais im Roman de Fauvel“, in: Die Musikforschung, XXXIV/2 (1981), pp. 165, 169-171 (GfM)
- Leo Schrade: „Guillaume de Machaut and the ‚Roman de Fauvel‘, in: Miscelánea en Homenaje a Monsenor Higinio Anglès, Barcelona: 1958-1961, vol.2, pp. 846-849
Einige Passagen dieses Artikels sind wortwörtlich in den Wikipedia-Artikel zum Lai (Fassung vom 13.09.08) übernommen worden, also nicht von mir geklaut, sondern von mir beigestiftet.